
An drei langen und sehr gut besuchten Abenden im Porgy & Bess kam ausnahmsweise kein Jazz zu Gehör sondern zeitgenössisches Liedgut aus der europäischen und amerikanischen Songwritingszene. Der Mix war ein sehr guter, wenn auch so manche Bands (an der Vorlage? An sich?) gescheitert sind. Neue Erkenntnisse wurden dabei ebenfalls gewonnen - so z.B., dass das Lied noch lange nicht am Ende angekommen ist und dass sich die Liedermacherszene zum Teil bis zur Unkenntlichkeit weiterentwickelte. Von Manfred Horak.
Hello Scandinavia
 Als die junge österreichische Liedermacherin Agnes Milewski
sich um ca. 2.15 Uhr vom Klavierstuhl erhob wirkte das bis dahin zahlreich
ausharrende Publikum doch schon etwas übermüdet, aber irgendwie auch glücklich,
dies, weil das Festival zwischen 23. und 25. November 2006 wenn schon nicht
alle so doch sehr viele Erwartungen erfüllte. Was (rein subjektiv betrachtet)
auffiel war die Steigerung von Abend zu Abend. War der erste Abend der
schwächste, gab es bereits am zweiten Abend eine deutliche Steigerung,
kulminierend am (gesamt betrachtet) besten Abend am dritten Festivaltag. Somit
gleich mal rein in den chronologischen Ablauf: Erschreckend schwach, mehr noch,
fehl am Platz die erste Band am ersten Abend, Hello Goodbye. Angekündigt als
„verspielter, aber nie oberflächlicher Lo-Fi-Indiepop, die Songs meist unter
der Drei-Minuten-Grenze“, bei dem Popharmonien auf Surfsound prallen sollten,
kam die norwegisch-schwedische Formation rund um Lisa Lundkvist und Frode Fivel
wie eine dilettantische Parodie auf The B-52’s in ihrer schwächsten
Karrierephase daher, die dabei gleichzeitig versuchten auch die 1950er Jahre
(Eddie Cochran!) bzw. die sehr frühen The Beatles unterzubringen. Die Texte?
Vergesst es. Höre Smöre Wencke Möhre kann man da nur sagen. Good bye.
Als die junge österreichische Liedermacherin Agnes Milewski
sich um ca. 2.15 Uhr vom Klavierstuhl erhob wirkte das bis dahin zahlreich
ausharrende Publikum doch schon etwas übermüdet, aber irgendwie auch glücklich,
dies, weil das Festival zwischen 23. und 25. November 2006 wenn schon nicht
alle so doch sehr viele Erwartungen erfüllte. Was (rein subjektiv betrachtet)
auffiel war die Steigerung von Abend zu Abend. War der erste Abend der
schwächste, gab es bereits am zweiten Abend eine deutliche Steigerung,
kulminierend am (gesamt betrachtet) besten Abend am dritten Festivaltag. Somit
gleich mal rein in den chronologischen Ablauf: Erschreckend schwach, mehr noch,
fehl am Platz die erste Band am ersten Abend, Hello Goodbye. Angekündigt als
„verspielter, aber nie oberflächlicher Lo-Fi-Indiepop, die Songs meist unter
der Drei-Minuten-Grenze“, bei dem Popharmonien auf Surfsound prallen sollten,
kam die norwegisch-schwedische Formation rund um Lisa Lundkvist und Frode Fivel
wie eine dilettantische Parodie auf The B-52’s in ihrer schwächsten
Karrierephase daher, die dabei gleichzeitig versuchten auch die 1950er Jahre
(Eddie Cochran!) bzw. die sehr frühen The Beatles unterzubringen. Die Texte?
Vergesst es. Höre Smöre Wencke Möhre kann man da nur sagen. Good bye.
Hohe Melodienquote

 „Aber hallo!“ rief man dafür umso erfreuter, erstaunter und
glücklicher aus, nachdem die dänischen Broken Beats ihr erstes Lied
absolvierten. Die Band um Kim Munk legte ein hinreißendes Set hin, geschmückt
mit vielen Verbeugungen vor der Musikgeschichte und vor allem mit einer
ordentlichen Tracht Individualismus und eigener Handschrift. Broken Beats kamen
dem schon verdammt nahe, was man sich unter sehr guter zeitgenössischer Liedermacherkunst
vorstellt und man kann nur hoffen, dass diese Band mal groß raus kommt – oder
zumindest wieder mal nach Österreich. Warum? Die Band arbeitet mit Elan an
einer gültigen Verbindung von Wahnsinn und Harmonie, Kratzbürstigkeit und
relevanten Texten, und tatsächlich gelingt ihnen das meiste ohne großartig mit
der Wimper zucken zu müssen. Hinzu kommt neben der hohen erfrischenden
Melodienquote ein formidables Geschichtenerzählertum, wie es in dieser Qualität
leider nur noch allzu selten vorkommt mit Liedtexten, die sich vor Niemanden
scheuen brauchen, auch nicht vor den Größten des Liedermacherolymps.
Sensationell. Nicht mehr. Und schon gar nicht weniger.
„Aber hallo!“ rief man dafür umso erfreuter, erstaunter und
glücklicher aus, nachdem die dänischen Broken Beats ihr erstes Lied
absolvierten. Die Band um Kim Munk legte ein hinreißendes Set hin, geschmückt
mit vielen Verbeugungen vor der Musikgeschichte und vor allem mit einer
ordentlichen Tracht Individualismus und eigener Handschrift. Broken Beats kamen
dem schon verdammt nahe, was man sich unter sehr guter zeitgenössischer Liedermacherkunst
vorstellt und man kann nur hoffen, dass diese Band mal groß raus kommt – oder
zumindest wieder mal nach Österreich. Warum? Die Band arbeitet mit Elan an
einer gültigen Verbindung von Wahnsinn und Harmonie, Kratzbürstigkeit und
relevanten Texten, und tatsächlich gelingt ihnen das meiste ohne großartig mit
der Wimper zucken zu müssen. Hinzu kommt neben der hohen erfrischenden
Melodienquote ein formidables Geschichtenerzählertum, wie es in dieser Qualität
leider nur noch allzu selten vorkommt mit Liedtexten, die sich vor Niemanden
scheuen brauchen, auch nicht vor den Größten des Liedermacherolymps.
Sensationell. Nicht mehr. Und schon gar nicht weniger.
Mit dem Paragleiter über die Fjorde

 Der nächste, Julian Berntzen aus Norwegen, nahm am
Klavierstuhl Platz und hielt Broken Beats ein Streichquartett entgegen. Es war
also ein sich deutlich abhebender Live-Auftritt im Vergleich zu den beiden
Vorgängerbands, da Berntzen mitunter die Stille suchte und dort, explizit, in
den Liedermachertopf eintauchte und als verträumter Ebenso wieder auftauchte.
Er stöberte in bekannten Quellen – von den Liverpooler Fab Four bis zum
kanadischen Cohen und mit Umwegen wieder retour – und schuf eine angenehme
Stimmung. Vielleicht sogar ein wenig zu angenehm. Gut, aber nicht essenziell.
Der nächste, Julian Berntzen aus Norwegen, nahm am
Klavierstuhl Platz und hielt Broken Beats ein Streichquartett entgegen. Es war
also ein sich deutlich abhebender Live-Auftritt im Vergleich zu den beiden
Vorgängerbands, da Berntzen mitunter die Stille suchte und dort, explizit, in
den Liedermachertopf eintauchte und als verträumter Ebenso wieder auftauchte.
Er stöberte in bekannten Quellen – von den Liverpooler Fab Four bis zum
kanadischen Cohen und mit Umwegen wieder retour – und schuf eine angenehme
Stimmung. Vielleicht sogar ein wenig zu angenehm. Gut, aber nicht essenziell.



Freakiger ging es da schon mit der norwegischen Partie Ai
Phoenix zu, die irgendwo zwischen beständiger Fragilität und sich langsam
aufbauenden Klangtürmen bewegen, stets auf der Suche nach jenem Schalter, mit
dem man die Zeit anhalten kann. Diese Band ist (im Vergleich zu allen vorhin
genannten) am nächsten dran, zu beweisen, dass es auch im
Singer-/Songwriter-Bereich einen eigenständigen „skandinavischen“ Sound gibt –
und nicht nur im Jazz, wobei mit ähnlichen subtilen Mitteln gehandwerkt wird
wie im improvisierten Musikbereich, also mit riesigen Klangflächen, die mal
gemächlich, mal stürmischer, wie ein Paragleiter über die Fjorde gleiten und
nur ab und zu bei einer abgelegenen Holzhütte landen, um dort wieder zurück in
die vertraute Liedstruktur zu finden.
Wo ist der nächste Copy-Shop?
Tag 2 war nur Dank Sandy
Dillon der bessere Blue Bird-Abend. Dies gleich mal vorweg. Wie bereits am
ersten Abend ging auch der zweite Abend mit einem deutlichen Fehlstart los. Der
österreichische Sänger und Gitarrist Fabian Patzak (falls Ihnen der Name
bekannt vorkommen sollte: Sein Vater ist Filmregisseur) huldigte dem großen
Townes Van Zandt – was ja an und für sich nicht schlecht ist. Nur, dass Fabian
Patzak sich dabei leider zu häufig im Co py-Shop aufhielt, und zumindest ich
halte so etwas überhaupt nicht aus. So stellte sich mir unentwegt (während F.P.
spielte) die Frage „Wozu?“ Vielleicht, weil zu wenige Menschen das gigantische
Werk von Townes Van Zandt kennen (wie man leider auch bei der Viennale 2006 mit
Erschrecken feststellen musste)? Für mich war das zu wenig. Von Eigenständigkeit
jedenfalls war er „Some Hundred Million Miles“ entfernt. Dem folgte dafür mit
dem Steiermärker Georg Altziebler, dessen Band auf den merkwürdigen Namen Son
of the Velvet Rat hört, jemand, der
bereits seine eigene Handschrift im Songwriting entwickelte. Viel mehr braucht
man über ihn an dieser Stelle auch gar nicht schreiben, denn man wird
sicherlich noch einiges über ihn auf Kulturwoche.at lesen können.
py-Shop aufhielt, und zumindest ich
halte so etwas überhaupt nicht aus. So stellte sich mir unentwegt (während F.P.
spielte) die Frage „Wozu?“ Vielleicht, weil zu wenige Menschen das gigantische
Werk von Townes Van Zandt kennen (wie man leider auch bei der Viennale 2006 mit
Erschrecken feststellen musste)? Für mich war das zu wenig. Von Eigenständigkeit
jedenfalls war er „Some Hundred Million Miles“ entfernt. Dem folgte dafür mit
dem Steiermärker Georg Altziebler, dessen Band auf den merkwürdigen Namen Son
of the Velvet Rat hört, jemand, der
bereits seine eigene Handschrift im Songwriting entwickelte. Viel mehr braucht
man über ihn an dieser Stelle auch gar nicht schreiben, denn man wird
sicherlich noch einiges über ihn auf Kulturwoche.at lesen können.
Loop me, Baby, loop me!
Die wohl größte Enttäuschung des gesamten Festivals fand
Platz zwischen Son of a Velvet Rat
und Sandy Dillon, die wiederum so
ziemlich das beste Konzert des Festivals, zumindest aber ein sehr Aufsehen
erregendes Konzert spielte, und hört auf den Namen Ed Harcourt. Perfektion ist
 sein zweiter Name und genau diese Perfektion ist zum Gähnen langweilig. Keine
Überraschungen, auch nicht ansatzweise – trotz oder wegen seiner Loop-Versuche
(die man, by the way, im Jazzbereich, z.B. von Wolfgang Muthspiel, um Eckhäuser
aufregender zu hören bekommt) – und trotz oder wegen dieser technischen
Firlefanzen nicht überdecken konnte, was ihm bei aller Perfektion und
technischem Können fehlt: Songs, die man sich merkt und Texte, bei denen man
aufhorcht.
sein zweiter Name und genau diese Perfektion ist zum Gähnen langweilig. Keine
Überraschungen, auch nicht ansatzweise – trotz oder wegen seiner Loop-Versuche
(die man, by the way, im Jazzbereich, z.B. von Wolfgang Muthspiel, um Eckhäuser
aufregender zu hören bekommt) – und trotz oder wegen dieser technischen
Firlefanzen nicht überdecken konnte, was ihm bei aller Perfektion und
technischem Können fehlt: Songs, die man sich merkt und Texte, bei denen man
aufhorcht.
Bluesmutationen einer spindeldürren Sängerin
Ein ganz anderes Kaliber ist da schon Sandy
Dillon, wie bereits erwähnt, der einsame Höhepunkt des zweiten Abends und
vermutlich auch der Höhepunkt des gesamten Festivals (Ed Harcourt war übrigens
ebenfalls in ihrem Set zu hören, als Sideman, und da gefiel er mir schon weitaus besser). Die spindeldürre Sängerin mit der rohen Stimme brachte ihre
Bluesmutationen zum Besten und präsentierte etliche Lieder aus ih rem neuen
Album „Pull the Strings“. Das war ein Live-Set zum Angreifen, da brodelte die
Energie wie nur was und da blies einem eine Authentizität mitten ins Gesicht,
das man sich nichts Anderes wünschte als jene hochenergetische Musik zu hören.
So laut wie nur möglich. Eines meiner Lieblingsalben von Tom Waits ist
„Heartattack & Vine“ aus dem Jahr 1980, und die Energie des Titelstücks ist
auch eine Energie, die in Sandy
Dillon inne wohnt. Und eins ist schon auch klar: Man liebt ihre Musik oder man
hasst sie. Dazwischen gibt es wohl nichts, und so war zwar die Zuneigung des
Publikums in der Überzahl, so manche aber zweifelten daran, soeben essenzielles
zu hören und verzichteten auf den Rest. Der „Rest“ war Punk, Blues, Hootenanny,
Improvisationen und Balladen. Ein Meer voller Tränen, Übermut,
Wankelhaftigkeit, Überzeugung, Wut, und weiß der Teufel was sonst noch alles
(ach ja, Gospel a la Dillon auch). Über allem stand die Macht ihrer Lieder.
Eine verzweifelte Macht, die Sehnsucht und Würde sucht und atmet. Ein
organisiertes Chaos. „Heartattack & Vine“ war einmal. Jetzt ist „Pull the
Strings“ von Sandy Dillon.
rem neuen
Album „Pull the Strings“. Das war ein Live-Set zum Angreifen, da brodelte die
Energie wie nur was und da blies einem eine Authentizität mitten ins Gesicht,
das man sich nichts Anderes wünschte als jene hochenergetische Musik zu hören.
So laut wie nur möglich. Eines meiner Lieblingsalben von Tom Waits ist
„Heartattack & Vine“ aus dem Jahr 1980, und die Energie des Titelstücks ist
auch eine Energie, die in Sandy
Dillon inne wohnt. Und eins ist schon auch klar: Man liebt ihre Musik oder man
hasst sie. Dazwischen gibt es wohl nichts, und so war zwar die Zuneigung des
Publikums in der Überzahl, so manche aber zweifelten daran, soeben essenzielles
zu hören und verzichteten auf den Rest. Der „Rest“ war Punk, Blues, Hootenanny,
Improvisationen und Balladen. Ein Meer voller Tränen, Übermut,
Wankelhaftigkeit, Überzeugung, Wut, und weiß der Teufel was sonst noch alles
(ach ja, Gospel a la Dillon auch). Über allem stand die Macht ihrer Lieder.
Eine verzweifelte Macht, die Sehnsucht und Würde sucht und atmet. Ein
organisiertes Chaos. „Heartattack & Vine“ war einmal. Jetzt ist „Pull the
Strings“ von Sandy Dillon.
Die Kompaktheit des dritten Abends
Was sollte da noch groß nachkommen? Soll ich überhaupt
hingehen? Ja, natürlich. Wenn schon, denn schon. So viel Zeit muss sein. Und
siehe da: der dritte Abend gefiel mir am kompaktesten, am meisten gelungen.
Erstens, weil kein Ausfall war, zweitens, weil das Ganze in sich sehr stimmig
ruhte. Ich stellte mir während des Festivals sehr oft
die Frage, was die (gerade gehörte)  Band denn noch mit klassischem
Singer-/Songwriting zu tun hat, egal ob sie mir nun gefiel oder nicht. Umso
weniger fragwürdig gestaltete sich sehr zu meiner Freude das Eröffnungskonzert
von Blue Bird 2006, am dritten Abend, nämlich mit Daniel Adam Smith. Seit
einigen Jahren lebt der sehr sympathische Amerikaner in Wien und
veröffentlichte im September 2006 sein formidables Debütalbum "Saltwater Days" beim Label
Buntspecht. Was seine zum Großteil sehr gelungenen Lieder auszeichnet hört auf
die Begriffe Melodie und Harmonie und man merkt seinen Songs auch sofort an,
dass ihm die Texte ebenso wichtig sind. Und, bitte schön: Was will man von
einem Liedermacher mehr erwarten? Mehr
über Daniel Adam Smith folgt in Kürze auf Kulturwoche.at.
Band denn noch mit klassischem
Singer-/Songwriting zu tun hat, egal ob sie mir nun gefiel oder nicht. Umso
weniger fragwürdig gestaltete sich sehr zu meiner Freude das Eröffnungskonzert
von Blue Bird 2006, am dritten Abend, nämlich mit Daniel Adam Smith. Seit
einigen Jahren lebt der sehr sympathische Amerikaner in Wien und
veröffentlichte im September 2006 sein formidables Debütalbum "Saltwater Days" beim Label
Buntspecht. Was seine zum Großteil sehr gelungenen Lieder auszeichnet hört auf
die Begriffe Melodie und Harmonie und man merkt seinen Songs auch sofort an,
dass ihm die Texte ebenso wichtig sind. Und, bitte schön: Was will man von
einem Liedermacher mehr erwarten? Mehr
über Daniel Adam Smith folgt in Kürze auf Kulturwoche.at.
Richtig klassisch. Klassisch gut.
Gänzlich eingedrungen ins klassische Liedermachertum ist das
Festival mit dem Auftritt von Stuart Moxham & Louis Philippe, einem
ungleichen Gespann britischer und französischer Herkunft, das dennoch
zueinander fand. Die zwei Sänger und Gitarristen wurden von einem
Kontrabassisten, der bisweilen auch am Flügel spielte, begleitet (und der
außerdem so manche Harmoniestörungen des Duos zu übertünchen wusste) und
spielten zwei Sets. Louis, äh – who? „Louis Philippe ist eins der bestgehüteten
Geheimnisse der Musikwelt“, schrieb vor einigen Jahren das
Plattensammler-Magazin „Record Collector“, ein Musiker, der vielleicht
irgendwann  einmal in Perfektion untergehen wird, und auch am Blue Bird-Abend diesen
Drang auslebte und dabei vorführte, wie viel Perfektion sein darf. Dort, wo die
Perfektion ein wenig ermattete (was aber nur selten vorkam), war Louis Philippe nicht nur
gemeinsam mit dem Kontrabassisten/Pianisten am Werk, sondern
auch sein Duettpartner Stuart Moxham, der einstige Mastermind von Young Marble
Giants. In manchen Momenten hörte man durchaus, dass sie anscheinend nur selten
live zusammen spielen (zumindest aus diesem Programm, das eine Vorschau auf
ihr gemeinsames Album präsentierte). Moxham ist sicherlich derjenige von
beiden, der weniger gewöhnungsbedürftig ist, aber auch jener, dessen Lieder im
Laufe des Konzerts ein wenig an Spannung verloren. Der Franzose hingegen –
superb! Allerfeinste Sahne, was er da vom Stapel ließ – Lieder aus den Anfangsjahren
des 20. Jahrhunderts ebenso wie französische Chansons und ein Lied von Brian Wilson, aber
natürlich auch Eigenmaterial. Einigen im Publikum (so mein dringender Verdacht)
war das zu schlicht und zu altertümlich, viele wurden davon allerdings
richtiggehend beseelt. Belüftet. Richtig klassisch. Klassisch gut.
einmal in Perfektion untergehen wird, und auch am Blue Bird-Abend diesen
Drang auslebte und dabei vorführte, wie viel Perfektion sein darf. Dort, wo die
Perfektion ein wenig ermattete (was aber nur selten vorkam), war Louis Philippe nicht nur
gemeinsam mit dem Kontrabassisten/Pianisten am Werk, sondern
auch sein Duettpartner Stuart Moxham, der einstige Mastermind von Young Marble
Giants. In manchen Momenten hörte man durchaus, dass sie anscheinend nur selten
live zusammen spielen (zumindest aus diesem Programm, das eine Vorschau auf
ihr gemeinsames Album präsentierte). Moxham ist sicherlich derjenige von
beiden, der weniger gewöhnungsbedürftig ist, aber auch jener, dessen Lieder im
Laufe des Konzerts ein wenig an Spannung verloren. Der Franzose hingegen –
superb! Allerfeinste Sahne, was er da vom Stapel ließ – Lieder aus den Anfangsjahren
des 20. Jahrhunderts ebenso wie französische Chansons und ein Lied von Brian Wilson, aber
natürlich auch Eigenmaterial. Einigen im Publikum (so mein dringender Verdacht)
war das zu schlicht und zu altertümlich, viele wurden davon allerdings
richtiggehend beseelt. Belüftet. Richtig klassisch. Klassisch gut.
Die lange Nacht der Popmusik
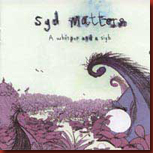 Aus Frankreich kam auch Syd Matters und Band. Da wurden
mehrere Gänge zugelegt und schon hatte das klassische Songwriting wieder das
Nachsehen. Die Performance überzeugte dennoch restlos, da ziemlich viel Druck
ausgeübt wurde, sprich: Das Publikum konnte sich wieder freier bewegen, also
tanzen, letztendlich war es aber „nur“ hervorragender Pop in einer langen
Nacht. Kurzum: Den Namen Syd Matters sollte man sich unbedingt merken. Höchst empfehlenswert ist auch seine CD "A Whisper Not A Sigh" .
Aus Frankreich kam auch Syd Matters und Band. Da wurden
mehrere Gänge zugelegt und schon hatte das klassische Songwriting wieder das
Nachsehen. Die Performance überzeugte dennoch restlos, da ziemlich viel Druck
ausgeübt wurde, sprich: Das Publikum konnte sich wieder freier bewegen, also
tanzen, letztendlich war es aber „nur“ hervorragender Pop in einer langen
Nacht. Kurzum: Den Namen Syd Matters sollte man sich unbedingt merken. Höchst empfehlenswert ist auch seine CD "A Whisper Not A Sigh" .
Die sehr eigenwillige britische Formation Psapp vollendete
den Abend – und auch hier – bzw. noch weniger als bei Syd Matters, stand das
klassische Songwriting im Vordergrund – und auch wieder nicht. Psapp brachte
luftig-lockeres und  heulsusisch-melancholisch-verzärtelt-sentimentales zum
Vorschein, waren ganz und gar nicht eine Band, die man sich bei einem
Songwriting-Festival erwartet und passten kurioserweise doch sehr gut dort hin.
Was vielleicht an der Sängerin mit ihren selbst gestrickten Katzen gelegen
haben mag, aber nicht nur. Einerseits kramte die Band in allerlei Trickkisten,
andererseits dürfte es ein von Beginn bis Schluss wohl durchdachter und
organisierter Auftritt gewesen sein ohne großartige Überraschungen für die
Band. Aber okay, ihr Schmäh kommt gut an, manchmal erinnerten sie mich sehr
stark an Senor Coconut, manchmal nicht, tanzbar wa
heulsusisch-melancholisch-verzärtelt-sentimentales zum
Vorschein, waren ganz und gar nicht eine Band, die man sich bei einem
Songwriting-Festival erwartet und passten kurioserweise doch sehr gut dort hin.
Was vielleicht an der Sängerin mit ihren selbst gestrickten Katzen gelegen
haben mag, aber nicht nur. Einerseits kramte die Band in allerlei Trickkisten,
andererseits dürfte es ein von Beginn bis Schluss wohl durchdachter und
organisierter Auftritt gewesen sein ohne großartige Überraschungen für die
Band. Aber okay, ihr Schmäh kommt gut an, manchmal erinnerten sie mich sehr
stark an Senor Coconut, manchmal nicht, tanzbar wa r es immer. Ein Popvergnügen,
mehr nicht.
r es immer. Ein Popvergnügen,
mehr nicht.
After Midnight
Mitternacht war da längst schon überschritten, als dann noch als letzte Zugabe Agnes Milewski die Bühne betrat, ihre neue Band und ihre neuen Lieder vorstellte. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten klanglicher Natur bürstete sie ihre Kompositionen zwar nicht gegen den Strich, dafür lehnte sie sich aber manchmal doch ein wenig zu weit Richtung Tori Amos, was einige Längen auslöste und vor allem Müdigkeit. (Text: Manfred Horak; Fotos: Michael Nemeskal, VSA, Rainer Rygalyk, HP von den Bands)
Link-Tipps:
Vienna Songwriting Association
Interview mit Sandy Dillon











