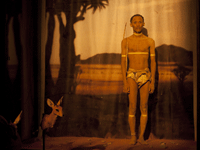Wie kann man das Leid eines ganzen Kontinents begreifbar machen? Nichts weniger versucht Brett Bailey mit seiner Ausstellung "Exhibit A: Deutsch-Südwestafrika" im Museum für Völkerkunde bei den Wiener Festwochen. Wer von der Betroffenheitskeule nicht getroffen wurde, war nicht dabei.
Wie kann man das Leid eines ganzen Kontinents begreifbar machen? Nichts weniger versucht Brett Bailey mit seiner Ausstellung "Exhibit A: Deutsch-Südwestafrika" im Museum für Völkerkunde bei den Wiener Festwochen. Wer von der Betroffenheitskeule nicht getroffen wurde, war nicht dabei.
|
Sehen Sie, wie weit wir gekommen sind. In diesem exotischen Drama sind Sie die Helden. Die eigene Rolle kann man sich in diesem höchst manipulativen Rundgang nicht aussuchen. Wir sind Täter, die Ausgestellten die Opfer. Mehr oder weniger freiwillig gibt eine schwarze Frau dem Aufseher ihr Kleid, schlüpft Eden Im ersten Raum "Eden" begegnet man der Geschichte der Herero, einem Stamm in Deutsch-Südwestafrika Ein Platz an der Sonne Nach den historischen Greueltaten, zu denen auch der ausgestopfte Angelo Soliman gezählt wird (der mehr als hundert Jahre früher gelebt hat und bereits zu Lebzeiten eine anerkannte Persönlichkeit war), wird man mit Asylwerbern aus Namibia, Ghana und Nigeria konfrontiert. Vom vierten sind nur noch die Schuhe da. Er wurde abgeschoben. Wie das in der Praxis aussehen kann, sieht man im nächsten Raum. Dort sitzt der mit Klebebändern gefesselte Omofuma. Glücklicherweise haben wir diese Art von rassistischer Barbarei überwunden. Oder haben wir das etwa nicht? Der südafrikanische Theatermacher Brett Bailey schwingt sich zum Opferanwalt auf. Waren seine plakativen Bilder der afrikanischen Hölle in Orfeus noch in eine Geschichte eingebunden, verzichtet er in Exhibit A: Deutsch-Südwestafrika großteils auf eine theatralische Brechung. Sorgfältig arrangiert muss diese undifferenzierte Aneinanderreihung beim Besucher zu Schuldgefühlen führen. So ist es auch. Ob Betroffenheit allerdings der richtige Ansatz gegen Rassismus ist, darf bezweifelt werden. (Text: Christine Koblitz; Fotos: Nurith Wagner-Strauss)
|
||